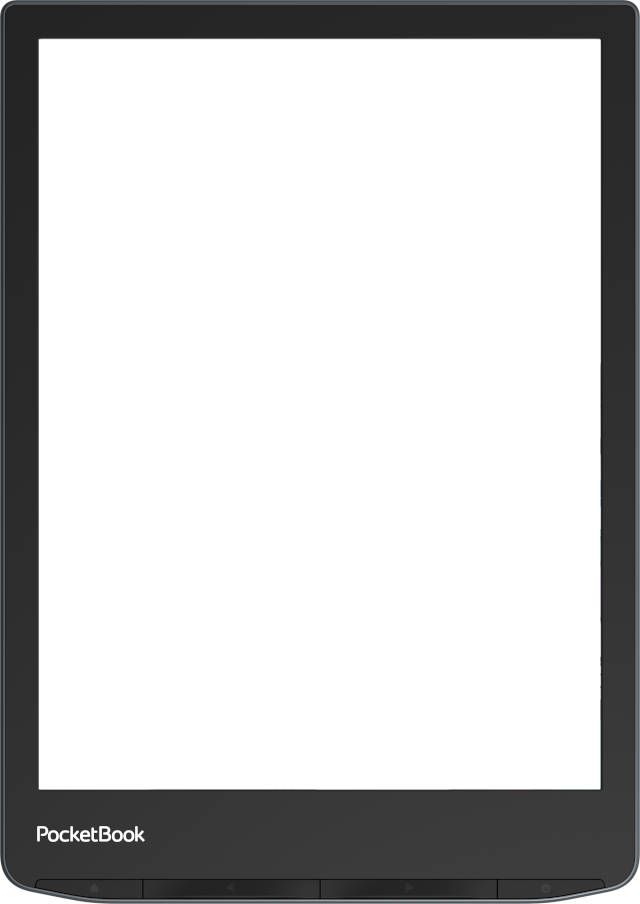Der unsichtbare Mann
E-Book (EPUB)
Aufbau Digital; Random House (2019)
688 Seiten
ISBN 978-3-8412-1697-7
EPUB sofort downloaden
Downloads sind nur für Kunden mit Rechnungsadresse in Österreich möglich!
€ 12,99
Kurztext / Annotation
»Einer der bedeutendsten Autoren der amerikanischen Nachkriegsliteratur.« Paul Ingendaay, FAZ.
Ralph Ellison, neben Toni Morrison und James Baldwin eine der großen Stimmen der afroamerikanischen Literatur der Gegenwart, gewann 1953 den National Book Award und wurde mit seinem gefeierten New-York-Roman schlagartig berühmt. Die Geschichte von der Odyssee eines namenlosen Schwarzen, die ihn von ganz oben bis ganz unten durch alle Schichten der amerikanischen Gesellschaft führt, ist eines der Lieblingsbücher von Barack Obama und bleibt hochaktuell: als schonungslose Abrechnung mit den alltäglichen rassistischen Ideologien und als Lob auf das gewachsene Selbstbewusstsein der noch immer um ihre selbstverständlichen Rechte Kämpfenden.
»Ich bin unsichtbar, verstehen Sie, weil sich die Leute weigern, mich zu sehen. Wer sich mir nähert, sieht nur meine Umgebung, sich selbst oder die Auswüchse seiner Phantasie - in der Tat alles und jedes, nur mich nicht.«
Ralph Waldo Ellison wurde 1914 in Oklahoma City geboren. Seine Eltern waren erst kurz zuvor aus South Carolina gekommen, so dass er über sie Einblicke in die schwarzen Erfahrungen in den ehemaligen Sklavenstaaten erhielt. Von 1933 bis 1936 studierte er Klassische Musik am Tuskegee Institute, einer der bekanntesten (damals ausschließlich) afroamerikanischen Bildungseinrichtungen. Mit dem Schreiben begann er nach einer Begegnung mit Richard Wright. 'Der unsichtbare Mann' wurde mit dem National Book Award ausgezeichnet, 1965 zum bedeutendsten Werk der letzten Jahrzehnte gewählt. Ellison war Professor für Literatur an verschiedenen amerikanischen Universitäten, zuletzt an der NYU. Er starb 1994 in New York.
Textauszug
Prolog
Ich bin ein unsichtbarer Mann. Nein, ich bin keine jener Spukgestalten, die Edgar Allan Poe heimsuchten, auch keines jener Kino-Ektoplasmen, wie sie in Hollywood produziert werden. Ich bin ein Mensch aus Substanz, aus Fleisch und Knochen, aus Fasern und Flüssigkeiten - ja, man könnte vielleicht sogar sagen, dass ich einen Verstand besitze. Ich bin unsichtbar, verstehen Sie, weil sich die Leute weigern, mich zu sehen. Es ist, als wäre ich von Zerrspiegeln aus hartem Glas umgeben, so wie die körperlosen Köpfe, die man mitunter auf Jahrmärkten sieht. Wer sich mir nähert, sieht nur meine Umgebung, sich selbst oder die Auswüchse seiner Phantasie - in der Tat alles und jedes, nur mich nicht.
Meine Unsichtbarkeit ist auch nicht durch die biochemische Beschaffenheit meiner Epidermis bedingt. Die Unsichtbarkeit, die ich meine, ist die Folge einer eigenartigen Disposition der Augen derer, mit denen ich in Kontakt komme, und zwar der Anlage ihrer inneren Augen, jener Augen, mit denen sie die Wirklichkeit durch ihre körperlichen Augen hindurch wahrnehmen. Ich beklage mich nicht, ich protestiere auch nicht. Manchmal hat es sogar sein Gutes, unsichtbar zu sein, auch wenn es meist ziemlich nervenzerrüttend ist. Außerdem stößt man fortwährend mit Leuten zusammen, die schlecht sehen. Oder man bekommt Zweifel, ob man wirklich existiert. Man fragt sich, ob man nicht einfach nur ein Phantom in den Köpfen der anderen ist. Etwa eine Gestalt in einem Alptraum, die der Schläfer mit aller Gewalt vernichten will. Sobald man so empfindet, fängt man aus Unmut an, den Stoß zu erwidern. Und ich muss gestehen, so empfindet man meistens. Man hat das quälende Bedürfnis, sich zu vergewissern, dass man in der realen Welt existiert, dass man ein Teil all des Lärms und all der Qual ist, und dann schlägt man mit den Fäusten um sich, flucht und verwünscht die anderen, damit sie einen erkennen. Aber leider hat das nur selten Erfolg.
Eines Abends stieß ich zufällig mit einem Mann zusammen. Vielleicht sah er mich, weil es schon fast dunkel war, und er beschimpfte mich. Ich sprang ihn an, packte ihn bei den Mantelaufschlägen und verlangte, dass er sich entschuldige. Er war ein großer blonder Mann, und als mein Gesicht dicht vor seinem war, blickte er mich aus seinen blauen Augen anmaßend an und verwünschte mich. Während er sich zu befreien suchte, wehte mir sein heißer Atem ins Gesicht. Ich rammte ihm meinen Schädel unters Kinn, verpasste ihm also einen Kopfstoß, wie ich es bei den Westindern gesehen hatte, und spürte, wie seine Haut aufplatzte und das Blut hervorquoll, und ich schrie: »Entschuldige dich! Entschuldige dich!« Er aber fluchte und wehrte sich weiter, und ich stieß immer wieder zu, bis er stark blutend einknickte. Mehrmals trat ich ihn, voller Wut, dass er mich immer noch beschimpfte, obwohl ihm schon blutiger Schaum auf den Lippen stand. O ja, ich trat ihn! Und in meiner Empörung zog ich mein Messer, um ihm in der menschenleeren Straße direkt unter der Laterne die Kehle durchzuschneiden. Mit der einen Hand hielt ich ihn am Kragen, und mit den Zähnen klappte ich das Messer auf - als mir plötzlich einfiel, dass der Mann mich nicht wirklich gesehen hatte; dass er glauben musste, in einem wandelnden Alptraum gefangen zu sein! Ich hielt inne, und die Klinge durchschnitt nur noch die Luft, während ich den Mann von mir weg auf die Straße stieß. Als die Scheinwerfer eines Autos die Dunkelheit durchstachen, konnte ich ihn genauer betrachten. Stöhnend lag er auf dem Asphalt, ein Mann, der beinahe von einem Phantom umgebracht worden wäre. Mein Mut schwand. Ich war angewidert und beschämt zugleich, wie ein Betrunkener, der auf geschwächten Beinen dahintorkelt. Und dann war ich belustigt: Etwas war dem dicken Schädel dieses Mannes entsprungen und hätte ihn fast totgeschlagen. Bei dieser wahnsinnigen Entdeckung begann ich zu lachen. Wäre er an der Schwelle des Todes aufgewacht? Hätte der Tod selbst ihn zu wachsam
Beschreibung für Leser
Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet