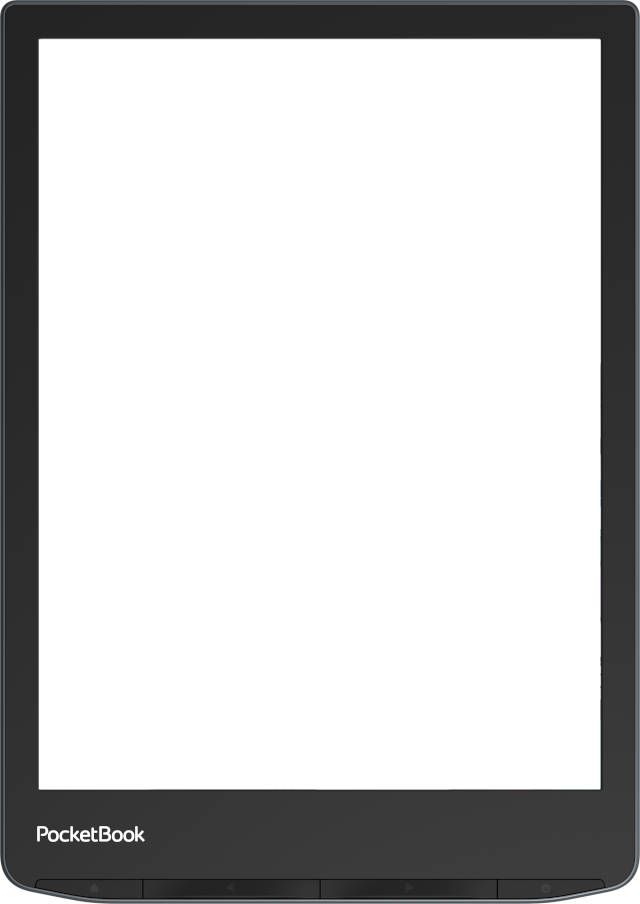Die Stärke der Frauen
E-Book (EPUB)
C. Bertelsmann Verlag; Macmillan Publishers: Flatiron Books (2022)
432 Seiten
ISBN 978-3-641-29014-6
EPUB sofort downloaden
Downloads sind nur für Kunden mit Rechnungsadresse in Österreich möglich!
Kurztext / Annotation
Die ergreifenden Schilderungen eines Arztes, der sein Leben dem Kampf gegen sexuellen Missbrauch verschrieben hat
Denis Mukwege, weltbekannter kongolesischer Gynäkologe und Menschenrechtsaktivist, hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Opfern sexueller Gewalt zu helfen. Als Gründer des Panzi-Hospitals in Bukavu erhielt er 2018 den Friedensnobelpreis für seinen Einsatz für die Gesundheit und Rechte von Frauen in der Demokratischen Republik Kongo. In seinem Buch verwebt er seine eigene dramatische Lebensgeschichte mit den Schilderungen einzelner Frauenschicksale. Auf das Drängen seiner Patientinnen hin, macht der Chirurg deren Leiden öffentlich und betont dabei die Willensstärke, mit der die Frauen sich ins Leben zurückkämpfen. Er fordert eine systemische Veränderung im Rollenverständnis, eine »positive Männlichkeit« für eine gleichberechtigte Gesellschaft, und belegt die Gewinne, die es bringt, wenn Frauen als Entscheidungsträgerinnen in wirtschaftliche und politische Prozesse eingebunden sind.
Die Stärke der Frauen ist der Bericht eines beeindruckenden Menschen, der sich nicht von seinem Weg abbringen lässt. Ein Bericht, der die Kraft der Frauen in den Vordergrund stellt und beweist, was das Engagement von Einzelnen bewirken kann.
Dr. Denis Mukwege wurde 1955 in Belgisch-Kongo geboren. Der Chirurg ist weltweit bekannt als der führende Experte in der operativen Behandlung von Vergewaltigungsopfern. Dieser Tätigkeit und dem unermüdlichen Einsatz für die Rechte seiner Patientinnen hat er sein Leben verschrieben, wofür er 2018 den Nobelpreis erhielt - gemeinsam mit der jesidischen Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad.
Textauszug
EINLEITUNG
Es ist ungewöhnlich, wenn ein Mann für die Rechte der Frauen kämpft. Das weiß ich. Ich habe es häufig bemerkt, wenn ich mich mit Freunden unterhalten habe, bei gesellschaftlichen Anlässen und mitunter auch bei professionellen Zusammenkünften. Die verständnislosen Blicke und die skeptischen Mienen sind mir nicht entgangen. Hin und wieder ist mir sogar, offen oder unausgesprochen, eine gewisse Feindseligkeit begegnet. Manche finden meine Entscheidungen verdächtig oder sogar bedrohlich.
Ich erinnere mich gut an Abendgesellschaften im Kongo und in Europa zu Beginn meiner Karriere: Wenn ich an der Reihe war, über meine Arbeit zu sprechen, erklärte ich meist, ich sei Gynäkologe und leitete ein Krankenhaus, das insbesondere Verletzungen behandele, die durch Vergewaltigungen verursacht worden seien. Und dass ich mich außerdem für die Rechte von Frauen engagierte. Danach wurde die Runde am Tisch im Allgemeinen recht still. Vielleicht stellte noch jemand höflichkeitshalber eine Frage, aber dann wechselte man rasch das Gesprächsthema.
In diesen Augenblicken betretenen Schweigens nahm ich jedoch auch Mitgefühl in den Augen der anderen Gäste wahr und stellte mir vor, was sie wohl über mich denken mochten: Was für einen schrecklichen Beruf ich hatte, und wie furchtbar das für mich sein musste. Ich entwickelte daher eine Art Gegenstrategie und betonte immer ausdrücklich, dass ich glücklich verheiratet sei und selbst Kinder hätte, als würde ich dadurch »normaler« wirken oder es den anderen leichter machen, meine Entscheidung nachzuvollziehen.
Wenn ich dann abends im Hotelzimmer oder zu Hause auf dem Bett lag, ärgerte ich mich jedes Mal über mich selbst. Warum empfand ich immer dieses Bedürfnis, mein Tun zu rechtfertigen? Jeder, der das Gefühl kennt, dass er »nicht so richtig dazupasst«, sei es aufgrund seiner Herkunft, Identität oder Erfahrung, wird wissen, was ich meine.
Aber nicht jeder hielt mit seiner Meinung hinter dem Berg. Ich erinnere mich an die Unterhaltung mit einem alten Freund, einem Klassenkameraden aus der Schulzeit, der in meiner Provinz Politiker geworden war. Noch jetzt, Jahre später, habe ich seine Worte nicht vergessen: »Seit du dich mit sexueller Gewalt beschäftigst, denkst du wie eine Frau«, sagte er. Das könnte man auch als Kompliment auffassen, aber so war es keineswegs gemeint.
Ich weiß auch noch genau, wie sehr ich mich bestätigt fühlte, als ich das Schreiben und die Arbeit von Stephen Lewis kennenlernte, kanadischer Diplomat, Aktivist und unermüdlicher Streiter für AIDS/HIV-Opfer in Afrika und Frauenrechte im Allgemeinen. Endlich hatte ich eine verwandte Seele gefunden. Durch Stephen habe ich begriffen, dass auch andere Männer so denken wie ich, und inzwischen ist er mir ein lieber Freund.
Ich betreue und behandele mittlerweile seit zwei Jahrzehnten Opfer sexueller Gewalt. Man könnte also meinen, ich müsste meine Entscheidung nicht mehr erklären. Das ist jedoch ein Irrtum. Nicht nur Männer haben Mühe, meine Entscheidung zu verstehen.
Vor einigen Jahren nahm ich an einem Treffen mit einer hochrangigen Vertreterin der Vereinten Nationen in New York City teil. Sie erklärte sich einverstanden, mich gemeinsam mit Mitstreitern zu treffen, die ebenfalls für Frauenrechte und Konfliktlösungen in meiner Heimat, der Demokratischen Republik Kongo, kämpften. Wir begaben uns in eines der oberen Stockwerke und wurden in ihr Büro gebeten, in dem ein langer Konferenztisch stand. Die Aussicht über den East River nach Queens und Brooklyn war atemberaubend.
Ihre aggressive Frage erwischte mich kalt. »Warum sind Sie hier, um über Frauenrechte im Kongo zu reden, und keine Frau aus Ihrem Land?«, fuhr sie mich an. »Sind die Frauen im Kongo nicht in der Lage, für sich selbst zu sprechen?«
Nun war ich ja gerade angereist, um die Unterstützung der Vereinten Nationen für Initiativen z
Beschreibung für Leser
Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet
- afrika
- aufklärung sexueller missbrauch
- biografie mukwege
- christina lamb
- der mann, der frauen repariert
- ebooks
- emazipation
- feminismus buch
- frauenrechte
- frauenschicksal
- friedensnobelpreis
- gewalt gegen frauen
- gynäkologe
- kongo
- kongo kampagne
- kriegsgewalt
- medizin
- menschenrechte
- menschenrechtspreis der vereinten nationen
- männer als feministen
- nadia murad
- neuerscheinung
- oprah winfrey
- sexuelle gewalt
- vergewaltigung als kriegswaffe
- vergewaltigungsopfer
- weltfrauentag
- zivilcourage