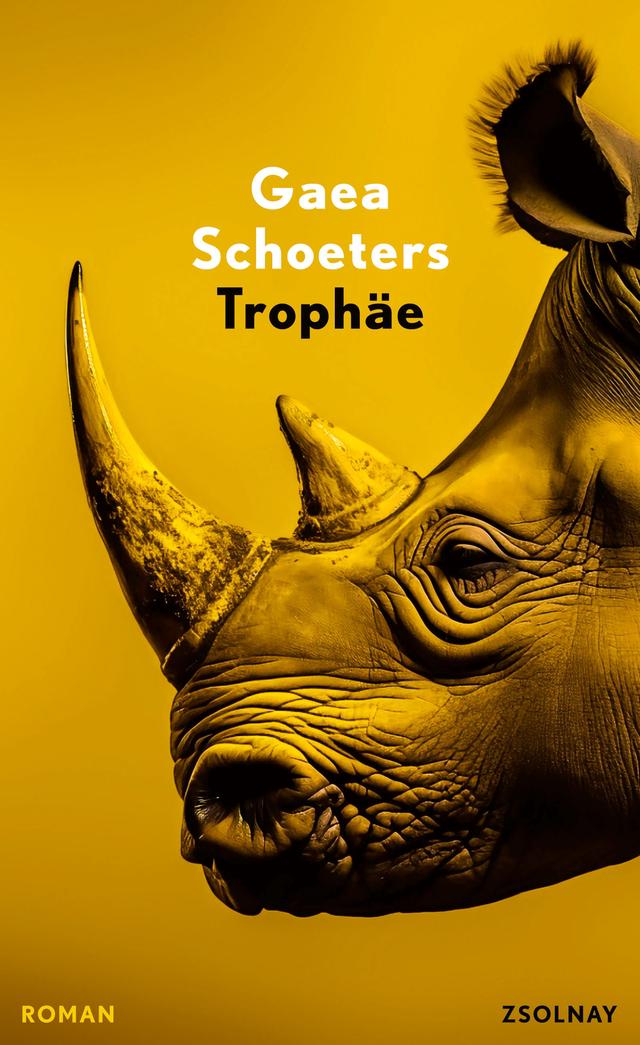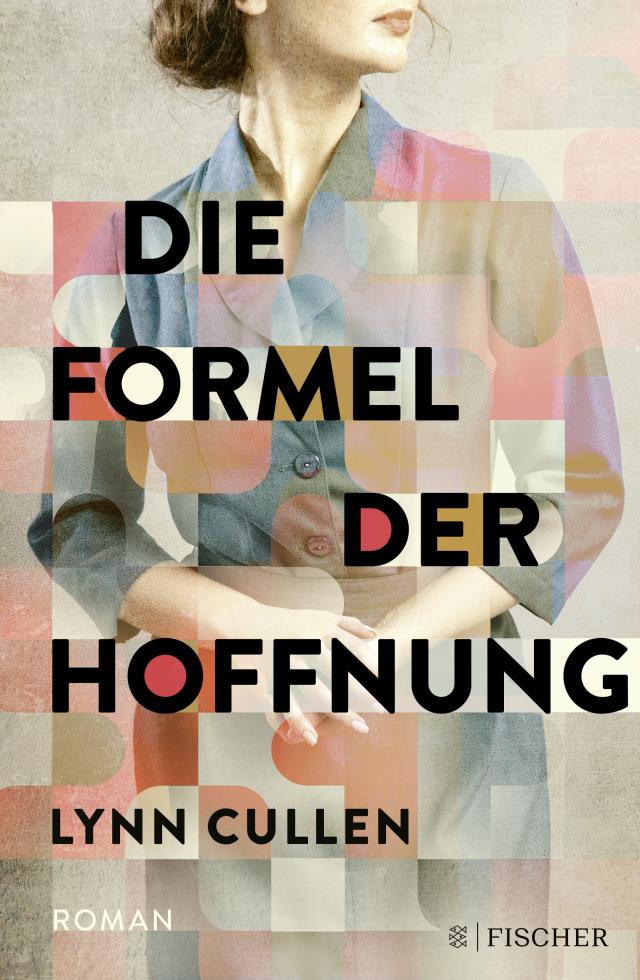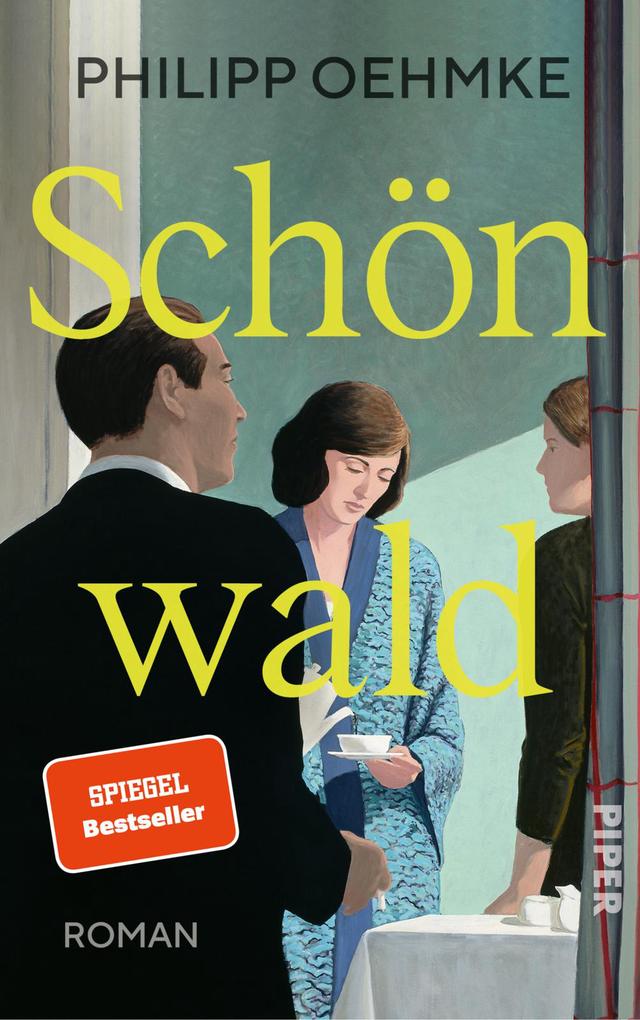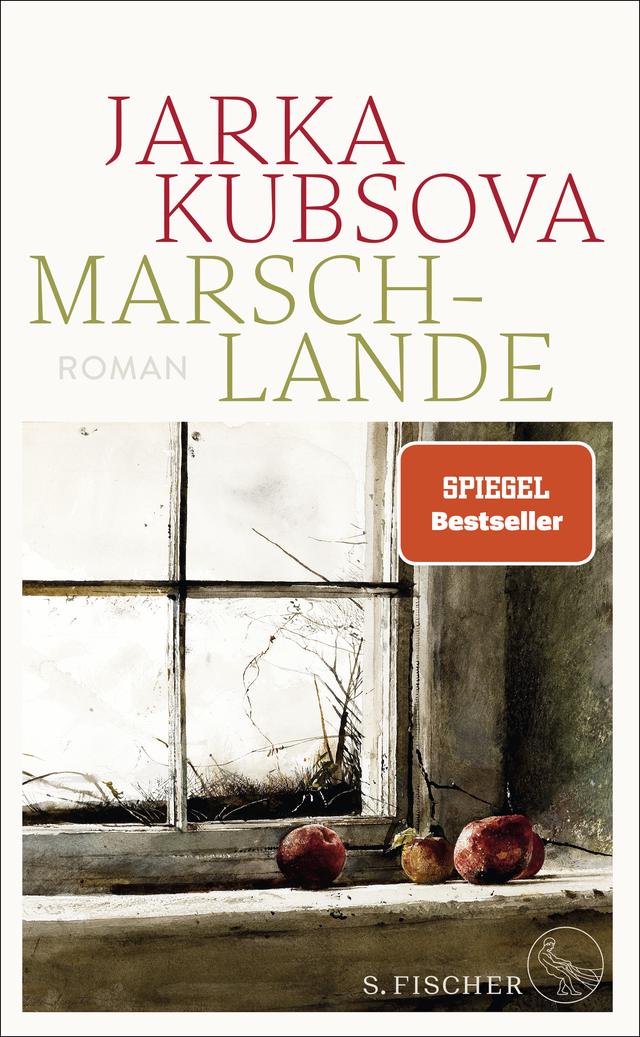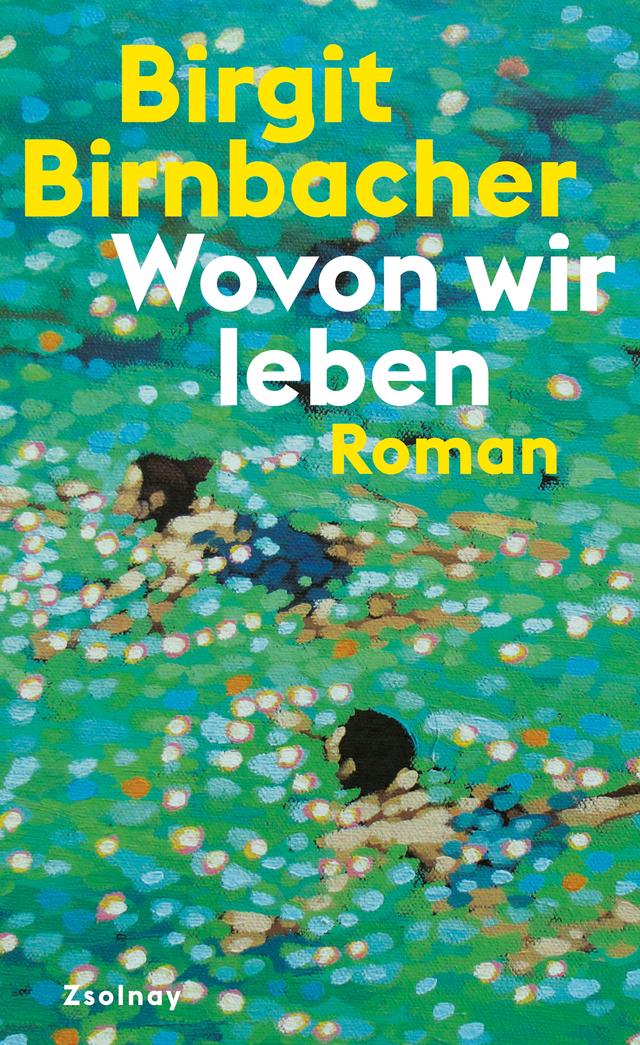Rezensionen
Rezensionen von HEYN Leserunde Petra Hesse
Autor: Simone Meier
„Meinetwegen impressionistisch“ oder selbstbezogen - 3 Sterne
Mit den Worten „meinetwegen impressionistisch“ ordnet die – fachlich wenig interessierte – Studentin der Kunstgeschichte, die als moderne Erzählerin fungiert, das Werk Vincent van Goghs ein. In der Folge versucht sie eine dokumentarisch-imaginative Annäherung über die Lebensgeschichte der Schwägerin des Malers, die nach dem frühen Tod ihres Mannes den Bildern des Schwagers zu weltweiter Berühmtheit verholfen und so dazu beigetragen hat, dass „der Kunstmarkt heute ein völlig perverser Handelsplatz für Milliardäre geworden ist …“ (S. 99-100).
Der Selbstzerstörung der Brüder van Gogh steht auf Seiten der Ich-Erzählerin eine Identitätsschwäche und die entsprechende Suche gegenüber: Sie meint, sich selbst in der schwer greifbaren, dafür umso lebhafter imaginierten Persönlichkeit Johannas, der Ehefrau Theo van Goghs, spiegeln zu können. Zudem orientiert sie sich an ihrem eigenen Vater, einem gescheiterten Schriftsteller, der sein Leben mit den Worten resümiert: „… das Fatale an der Kunst ist, dass es kein Zurück gibt. Wenn du es einmal geschafft hast, … dann lässt dich die Sehnsucht nach dieser besten Fassung deines Lebens nie mehr los …“ (S. 124).
Ist dieser Roman eine „beste Fassung“ der Ich-Erzählerin Gina? Kunst und Leben kommen in ihm nicht recht zusammen, aber die Suche geht weiter – allerdings führt sie weder zu Vincent van Gogh noch zu einer heute vorstellbaren KünstlerInnen-Existenz. Es bleibt der Mythos vom Großen Künstler, die Sehnsucht nach Liebe und Leben bleibt eine andere, und der Roman irgendwie unentschieden und blass.
Der Selbstzerstörung der Brüder van Gogh steht auf Seiten der Ich-Erzählerin eine Identitätsschwäche und die entsprechende Suche gegenüber: Sie meint, sich selbst in der schwer greifbaren, dafür umso lebhafter imaginierten Persönlichkeit Johannas, der Ehefrau Theo van Goghs, spiegeln zu können. Zudem orientiert sie sich an ihrem eigenen Vater, einem gescheiterten Schriftsteller, der sein Leben mit den Worten resümiert: „… das Fatale an der Kunst ist, dass es kein Zurück gibt. Wenn du es einmal geschafft hast, … dann lässt dich die Sehnsucht nach dieser besten Fassung deines Lebens nie mehr los …“ (S. 124).
Ist dieser Roman eine „beste Fassung“ der Ich-Erzählerin Gina? Kunst und Leben kommen in ihm nicht recht zusammen, aber die Suche geht weiter – allerdings führt sie weder zu Vincent van Gogh noch zu einer heute vorstellbaren KünstlerInnen-Existenz. Es bleibt der Mythos vom Großen Künstler, die Sehnsucht nach Liebe und Leben bleibt eine andere, und der Roman irgendwie unentschieden und blass.
Autor: Gaea Schoeters
"Er, Hunter, [wer oder was?]." - 5 Sterne
Der Roman erzählt von einer Jagd, die sich zwischen einem Satz des ersten Kapitels und einer Variation dieses Satzes im vorletzten Kapitel quasi aufspannt: "Das hier, das spürt er, bedeutet leben. Hier, die Gefahr zum Greifen nahe, kann er sein, wer er wirklich ist. Er, Hunter, Mann." (S. 27) und "[...] klammert sich mit aller Macht am Leben fest. Und lehnt sich auf. Er, Hunter, Mensch, wird nicht sterben." (S. 236)
Der erste Satz scheint das Psychogramm eines Mannes vom Typ Jäger und (Trophäen-)Sammler anzukündigen, wie ihn besonders Frauen kennen, und das nicht nur von Safaris. Die leicht veränderte Wiederholung des Satzes verschiebt seine Bedeutung ins Allgemein-Menschliche: hin zur Frage nach dem Zusammenhang von Natur und Zivilisation, von animalischer Herkunft und humaner Zukunft, von Instinkt und Vernunft, Kolonisten und Kolonisierten, Großwildjagd und Artenschutz, Macht und Moral ...
Die Zugehörigkeit des Jägers, der aus der Familientradition heraus den sprechenden Namen Hunter erhalten hat, zu einem der Pole wirkt nur auf den ersten Blick eindeutig. So glaubt Hunter an die eigene Überlegenheit und die Überlegenheit moderner Technik über die "primitive" (Über-)Lebensweise der Buschleute. Andererseits will er jagen wie ein Tier unter Tieren und unterliegt dem Buschmann schließlich im Kampf ums Überleben. Dieser sucht seinerseits im "silbernen Vogel" einer Fluggesellschaft den Anschluss an die naturferne westliche Welt.
Diese grundlegende Ambivalenz verleiht den Schilderungen der Innenwelt des Menschen und seiner Wahrnehmung der äußeren Savanne in jeder Episode des Erzählens immer neue Faszination. So abstoßend die Verstümmelung der Beute durch wildernde Jäger, aber auch der Mord des zahlenden und daher "legitimen" Jägers auch ist, ich musste weiterlesen – und dies nicht nur, weil eine Rezension zu schreiben war. Ein fesselndes Buch, das einen auch nach dem Ende der Lektüre nicht mehr loslässt.
Der erste Satz scheint das Psychogramm eines Mannes vom Typ Jäger und (Trophäen-)Sammler anzukündigen, wie ihn besonders Frauen kennen, und das nicht nur von Safaris. Die leicht veränderte Wiederholung des Satzes verschiebt seine Bedeutung ins Allgemein-Menschliche: hin zur Frage nach dem Zusammenhang von Natur und Zivilisation, von animalischer Herkunft und humaner Zukunft, von Instinkt und Vernunft, Kolonisten und Kolonisierten, Großwildjagd und Artenschutz, Macht und Moral ...
Die Zugehörigkeit des Jägers, der aus der Familientradition heraus den sprechenden Namen Hunter erhalten hat, zu einem der Pole wirkt nur auf den ersten Blick eindeutig. So glaubt Hunter an die eigene Überlegenheit und die Überlegenheit moderner Technik über die "primitive" (Über-)Lebensweise der Buschleute. Andererseits will er jagen wie ein Tier unter Tieren und unterliegt dem Buschmann schließlich im Kampf ums Überleben. Dieser sucht seinerseits im "silbernen Vogel" einer Fluggesellschaft den Anschluss an die naturferne westliche Welt.
Diese grundlegende Ambivalenz verleiht den Schilderungen der Innenwelt des Menschen und seiner Wahrnehmung der äußeren Savanne in jeder Episode des Erzählens immer neue Faszination. So abstoßend die Verstümmelung der Beute durch wildernde Jäger, aber auch der Mord des zahlenden und daher "legitimen" Jägers auch ist, ich musste weiterlesen – und dies nicht nur, weil eine Rezension zu schreiben war. Ein fesselndes Buch, das einen auch nach dem Ende der Lektüre nicht mehr loslässt.
Autor: Anna Neata
Eher eine Photostrecke - 3 Sterne
Dieses Buch hätte sich – wäre das technisch möglich – zwei Beurteilungen verdient: ein "sehr gut" und ein "schlecht".
Das sehr Gute zuerst: Einzelne Episoden in der Geschichte einer Familie sind wunderbar plastisch geschildert und liefern dabei fast unbemerkt jene Informationen, auf die es im Vergangenen schon mehr oder minder heimliche Hinweise gab bzw. die im Weiteren deutlicher entfaltet werden. Beispielhaft versammelt gleich das erste Kapitel sämtliche Figuren, Handlungsstränge und Probleme, aus denen dann der Roman aufgebaut wird. Und die "Sonnenfinsternis" aus der Kapitel-Überschrift kann auch auf symbolischer Ebene als Zustandsbeschreibung für alle drei Generationen von Frauen dieser Familie gelesen werden.
Damit beginnt aber auch schon die Kritik: An die jeweiligen Zeit- und Lebensumstände angepasst, verharren Großmutter, Tochter und Enkelin in einer unselbständigen, fremdbestimmten und auch sprachlich reduzierten Lebensweise. Dem entspricht nicht nur die Nähe der Figurenrede zur Alltagssprache, es motiviert auch die Dialekt-Merkmale des gesamten Erzählens. In der Wiederholung wird vorgeführt, dass das vorrangige und unveränderte Interesse im Leben einer Frau die Suche eines Mannes darstellt (daran ändert weder eine lesbische Beziehung noch das Ausweichen in die Selbstbefriedigung grundsätzlich etwas). Der Überdruss, der sich infolge dessen mit fortschreitender Lektüre einstellt und verstärkt, ließ in mir den Wunsch aufkommen, der Text wäre nicht als Roman, sondern als eine Reihe selbständiger Erzählungen konzipiert, die jeweils ein Schlaglicht auf eine kurze Episode werfen – vergleichbar vielleicht mit einer Photostrecke.
Das sehr Gute zuerst: Einzelne Episoden in der Geschichte einer Familie sind wunderbar plastisch geschildert und liefern dabei fast unbemerkt jene Informationen, auf die es im Vergangenen schon mehr oder minder heimliche Hinweise gab bzw. die im Weiteren deutlicher entfaltet werden. Beispielhaft versammelt gleich das erste Kapitel sämtliche Figuren, Handlungsstränge und Probleme, aus denen dann der Roman aufgebaut wird. Und die "Sonnenfinsternis" aus der Kapitel-Überschrift kann auch auf symbolischer Ebene als Zustandsbeschreibung für alle drei Generationen von Frauen dieser Familie gelesen werden.
Damit beginnt aber auch schon die Kritik: An die jeweiligen Zeit- und Lebensumstände angepasst, verharren Großmutter, Tochter und Enkelin in einer unselbständigen, fremdbestimmten und auch sprachlich reduzierten Lebensweise. Dem entspricht nicht nur die Nähe der Figurenrede zur Alltagssprache, es motiviert auch die Dialekt-Merkmale des gesamten Erzählens. In der Wiederholung wird vorgeführt, dass das vorrangige und unveränderte Interesse im Leben einer Frau die Suche eines Mannes darstellt (daran ändert weder eine lesbische Beziehung noch das Ausweichen in die Selbstbefriedigung grundsätzlich etwas). Der Überdruss, der sich infolge dessen mit fortschreitender Lektüre einstellt und verstärkt, ließ in mir den Wunsch aufkommen, der Text wäre nicht als Roman, sondern als eine Reihe selbständiger Erzählungen konzipiert, die jeweils ein Schlaglicht auf eine kurze Episode werfen – vergleichbar vielleicht mit einer Photostrecke.
Autor: Cullen, Lynn
„Eine bemerkenswerte Frau. Recht gescheit.“ (S. 103) - 3 Sterne
Mit dieser wohlwollend-herablassenden Beurteilung weist ein in der Polio-Forschung tätiger Virologe im Roman einer promovierten Mathematikerin ihren Platz in der Hierarchie zu: Sie hat – als Sekretärin – zu (be-)dienen. Und so lassen sich auch Karrieren be- und verhindern: Die Ärztin Dorothy M. Horstmann hat Dienst am Krankenbett zu leisten, sie hat die eigene Institution bei Kongressen zu vertreten, und sie hat ihre Forschungsergebnisse wieder und wieder zu überprüfen, damit nur ja kein – weiblicher! – Fehler publiziert wird. Dabei lautet eine Grundregel des modernen Wissenschaftsbetriebs: Publish or perish, publiziere oder geh unter – die Heldin des Romans wird mithilfe der genannten Anforderungen an der Publikation wesentlicher Forschungsergebnisse gehindert. Diese Mechanismen, die bis heute mit freundlichem Lächeln angewandt werden, führt der Text eindrücklich vor – keine ganz neue Einsicht, aber in dieser Anschaulichkeit doch ein positiver Schritt feministischer Erkenntnis.
Allerdings schleicht sich im Zuge der Lektüre langsam ein anderer Verdacht ein: Warum nimmt uns das Erzählen nie mit an den Ort der Arbeit, d. h. der Forschung einer Frau, die dieser Tätigkeit offenbar die höchste Priorität in ihrem Leben einräumt? Wir erfahren, dass sie die Liebe ihres Lebens zuerst vorläufig und dann endgültig zugunsten ihrer Forschung aufgibt, aber wir sehen sie nicht an ihrem Arbeitsort, im Forschungslabor. Ein kurzer Blick durch das Mikroskop auf die kleinen, gefräßigen Viren ist alles, was der Text an Wissenschaftsgeschichte abbildet – aber: Mit welcher Auflösung arbeiteten Mikroskope in den 1940-50er Jahren? Wie sah der Umgang mit Petri-Schalen in dieser Zeit aus? Gab es zur Gewinnung von Tot-Impfstoff nur das geschilderte Verfahren der Zerkleinerung und vielfachen Verdünnung von infiziertem Gewebe? etc.
Frauen gelten, Jahrhunderte alten religiös-gesellschaftlichen Stereotypen zufolge, als emotionale Wesen, gegenüber der rational bestimmten Männlichkeit. Und genau diesen stereotypen Gegensatz reproduziert der Roman, indem er der Heldin zunächst die Liebe, dann aber v. a. die Sorge-Arbeit am Krankenbett zuweist; die erfolgreiche Forschung bleibt den männlichen Kollegen vorbehalten. Ich hätte Dr. Dorothy M. Horstmann gern als Leiterin einer Reise in die Medizingeschichte gesehen, aber diese Ehre gesteht ihr ein nur vordergründig feministischer Roman noch immer nicht zu – entsprechend den wenigen Quellen, die sich im Internet zu der historischen Persönlichkeit finden lassen. Ein historisch orientierter Feminismus hat es auch mit einer erschwerten Forschungslage zu tun, und dafür ist der Roman (k-)ein gutes Beispiel.
Allerdings schleicht sich im Zuge der Lektüre langsam ein anderer Verdacht ein: Warum nimmt uns das Erzählen nie mit an den Ort der Arbeit, d. h. der Forschung einer Frau, die dieser Tätigkeit offenbar die höchste Priorität in ihrem Leben einräumt? Wir erfahren, dass sie die Liebe ihres Lebens zuerst vorläufig und dann endgültig zugunsten ihrer Forschung aufgibt, aber wir sehen sie nicht an ihrem Arbeitsort, im Forschungslabor. Ein kurzer Blick durch das Mikroskop auf die kleinen, gefräßigen Viren ist alles, was der Text an Wissenschaftsgeschichte abbildet – aber: Mit welcher Auflösung arbeiteten Mikroskope in den 1940-50er Jahren? Wie sah der Umgang mit Petri-Schalen in dieser Zeit aus? Gab es zur Gewinnung von Tot-Impfstoff nur das geschilderte Verfahren der Zerkleinerung und vielfachen Verdünnung von infiziertem Gewebe? etc.
Frauen gelten, Jahrhunderte alten religiös-gesellschaftlichen Stereotypen zufolge, als emotionale Wesen, gegenüber der rational bestimmten Männlichkeit. Und genau diesen stereotypen Gegensatz reproduziert der Roman, indem er der Heldin zunächst die Liebe, dann aber v. a. die Sorge-Arbeit am Krankenbett zuweist; die erfolgreiche Forschung bleibt den männlichen Kollegen vorbehalten. Ich hätte Dr. Dorothy M. Horstmann gern als Leiterin einer Reise in die Medizingeschichte gesehen, aber diese Ehre gesteht ihr ein nur vordergründig feministischer Roman noch immer nicht zu – entsprechend den wenigen Quellen, die sich im Internet zu der historischen Persönlichkeit finden lassen. Ein historisch orientierter Feminismus hat es auch mit einer erschwerten Forschungslage zu tun, und dafür ist der Roman (k-)ein gutes Beispiel.
Autor: Nicola Upson
Keine Agatha Christie, leider - 3 Sterne
Das Sujet dieses Kriminalromans kommt als Anleihe bei Agatha Christie daher: In ihrem meistverkauften Roman „Ten Little Niggers“ (1939; amerikanische Ausgabe: „And Then There Where None“, New York 1940) werden einige Gäste nobel auf eine Insel eingeladen, die Verbindung zum Festland reißt kurz darauf ab, und in der geschlossenen Inselgesellschaft passieren nacheinander mehrere Morde, offenbar im Zusammenhang mit Verbrechen, die weit zurückliegen. Angst, gegenseitiges Misstrauen und kriminalistischer Spürsinn treten in Aktion, und schließlich klären sich Täterschaft, Ursachen und Verantwortung.
Auf einem entsprechenden Gerüst aufbauend vollzieht Nicola Upson einen Schwenk zu populärpsychologischem Erzählen, das allerdings laienhaft anmutet und nicht recht zu überzeugen vermag. Die Anwesenheit historischer Figuren wie Marlene Dietrich bleibt weitgehend funktionslos; allenfalls deutet sich im Hinblick auf sie die – letztlich falsche – Fährte zu einer Nazi-Täterschaft an. Verschiebt sich dann auch noch der Schutzumschlag beim Lesen leicht nach oben, so sieht man selbst sich Aug‘ in Auge mit Marlene … elegant, but so what? Wirkliche Spannung entsteht anders.
Auf einem entsprechenden Gerüst aufbauend vollzieht Nicola Upson einen Schwenk zu populärpsychologischem Erzählen, das allerdings laienhaft anmutet und nicht recht zu überzeugen vermag. Die Anwesenheit historischer Figuren wie Marlene Dietrich bleibt weitgehend funktionslos; allenfalls deutet sich im Hinblick auf sie die – letztlich falsche – Fährte zu einer Nazi-Täterschaft an. Verschiebt sich dann auch noch der Schutzumschlag beim Lesen leicht nach oben, so sieht man selbst sich Aug‘ in Auge mit Marlene … elegant, but so what? Wirkliche Spannung entsteht anders.
Autor: Philipp Oehmke
Zeitgeist trifft Leichen aus dem Familienkeller - 4 Sterne
Familientreffen – und alte Tabus fliegen auf, Geheimnisse werden ans Licht gezerrt, und mühsam aufgebaute Rollenvorstellungen fallen in sich zusammen. So weit, so bekannt, denn irgendjemand sucht immer die Wahrheit und stört den vermeintlichen Frieden.
Dann aber die Frage, welche Strategien dabei zum Einsatz kommen? Welche Motive dahinterstecken? Was die eigene Wahrheit derer ist, die die Wahrheit der anderen suchen? Kurz: ein erzählerischer Versuch der Dekonstruktion des Topos „Familiengeheimnis“.
Da sind die Eltern bzw. Großeltern, die nicht immer alles so ganz genau wissen wollen und Gespräche beizeiten abklemmen: beherrschend Ruth, die für ihre berufliche Selbstverwirklichung zeitweilig ihre Ehe und die Unversehrtheit ihrer Tochter riskiert hat; ihr Mann, dessen Anteil an der Familienarbeit sich offenbar auf das abendliche Vorlesen für die – bereits gefütterten und gewaschenen – Kinder beschränkt hat. Die drei Kinder selbst schwimmen als Erwachsene auf modischen Diskursen mit, hinter denen sich berufliches Scheitern, Traumatisierung und mangelndes Durchsetzungsvermögen verbergen lassen. Selbst ihre Gegner, die Insta-Kids, die der Familie die ungebrochene Kontinuität der Finanzströme aus der Nazi-Zeit vorwerfen, ohne individuell zu recherchieren, verbergen hinter diesem Anliegen ihre eigenen migrantischen Erfahrungen und Kränkungen.
Die letzte Episode hingegen gehört einer angeheirateten, schnell wieder geschiedenen Figur, die nicht von der Wahrheit, sondern vom Essen motiviert ist – eine ironisch versöhnliche Wendung nach dem Abgang aller problembeladenen Schönwalds. Eine derartige Verweigerung des finalen Showdown könnte Kriege verhindern oder zumindest Familienromane verkürzen ;-)
Dann aber die Frage, welche Strategien dabei zum Einsatz kommen? Welche Motive dahinterstecken? Was die eigene Wahrheit derer ist, die die Wahrheit der anderen suchen? Kurz: ein erzählerischer Versuch der Dekonstruktion des Topos „Familiengeheimnis“.
Da sind die Eltern bzw. Großeltern, die nicht immer alles so ganz genau wissen wollen und Gespräche beizeiten abklemmen: beherrschend Ruth, die für ihre berufliche Selbstverwirklichung zeitweilig ihre Ehe und die Unversehrtheit ihrer Tochter riskiert hat; ihr Mann, dessen Anteil an der Familienarbeit sich offenbar auf das abendliche Vorlesen für die – bereits gefütterten und gewaschenen – Kinder beschränkt hat. Die drei Kinder selbst schwimmen als Erwachsene auf modischen Diskursen mit, hinter denen sich berufliches Scheitern, Traumatisierung und mangelndes Durchsetzungsvermögen verbergen lassen. Selbst ihre Gegner, die Insta-Kids, die der Familie die ungebrochene Kontinuität der Finanzströme aus der Nazi-Zeit vorwerfen, ohne individuell zu recherchieren, verbergen hinter diesem Anliegen ihre eigenen migrantischen Erfahrungen und Kränkungen.
Die letzte Episode hingegen gehört einer angeheirateten, schnell wieder geschiedenen Figur, die nicht von der Wahrheit, sondern vom Essen motiviert ist – eine ironisch versöhnliche Wendung nach dem Abgang aller problembeladenen Schönwalds. Eine derartige Verweigerung des finalen Showdown könnte Kriege verhindern oder zumindest Familienromane verkürzen ;-)
Autor: Jarka Kubsova
Eine Frau ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Fahrrad, oder… - 5 Sterne
… wie ein Fisch auf dem Trockenen? Sowohl der feministische als auch der machistische Spruch verweisen bildhaft auf eine Erfahrung, die zwei verschiedene Frauenfiguren des Romans machen: eine Marschlandbäuerin des 16. Jahrhunderts und eine Hamburger Wissenschaftlerin der Gegenwart. Beide entscheiden sich für ein selbstbestimmtes Leben ohne Ehemann und werden in der Folge von ihrem gesellschaftlichen Umfeld als „anders“ wahrgenommen. In diesem Anders-Sein wurzelt das Interesse der späteren an der Überlieferung von der früheren Frau. So entstehen zwei teilweise parallel geführte Erzählungen von Ausgrenzung und Verlust / Gewinn, die sich der seltenen Gattung des Doppelromans zuordnen lassen. Diese Erzählstruktur beleuchtet allerdings neben schicksalhaften Gemeinsamkeiten auch die Unterschiede in den beiden Frauenleben, in ihren charakterlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen. Und gerade die Reflexion über die Unterschiede macht den Roman zu mehr als einem feministischen Manifest.
Autor: Anthony Mccarten
DATEN = MACHT + VERKNÜPFUNG --> ALLMACHT = GOTT ... - 5 Sterne
… oder: Was absolute Macht für das Individuum, das sich ihr unterwirft, bedeuten kann – so lässt sich die Thematik dieses Thrillers beschreiben. Die Antwort fasst bereits der Titel zusammen: die Notwendigkeit, sich selbst auf Null zu setzen, sich zum Verschwinden zu bringen.
Die Terminologie entstammt einem Spiel, in dem die geballte Macht von staatlichen Sicherheitsorganen und Hightech gegen zehn Individuen antritt. Diese können dem Private Public Partnership „Fusion“ nur ein erfindungsreiches Lowtech oder, besser noch, Notech entgegensetzen, um nicht geortet und ergriffen zu werden. Die Wertschätzung der Einzelnen durch „Fusion“ lässt sich bereits an ihrer Bezeichnung als „Zero“ mit durchgehender Nummerierung von eins bis zehn ablesen.
Die Erzählweise scheint zunächst einfach: Von Kapitel zu Kapitel schwenkt die Aufmerksamkeit auf die jeweils andere Seite und rückt die Denk- und Arbeitsweise von deren Protagonisten und Protagonistinnen in den Fokus. Ab der Mitte der 460 Seiten, wenn die Hälfte der Individuen schon geschnappt ist, könnte dieses Verfahren langsam langweilig werden, doch da werden die Verhältnisse auf beiden Seiten immer komplexer: Zero 10 verdoppelt sich, und in der Geschlossenheit von „Fusion“ tun sich unerwartet Risse auf; zudem offenbaren anfängliche Antagonisten plötzlich gewisse Ähnlichkeiten – wo Menschen agieren, gibt es keine dauerhafte Eindeutigkeit. Kurz: aus Spiel wird Ernst, und die Spannung steigt. Dabei gerät die raffinierte Gestaltung erzählerischer Einzelheiten nie aus dem Blick, z. B. der Klang von Eigennamen, die eine Nähe zur außerliterarischen Realität andeuten und zugleich verneinen.
Abschließend ein zweifaches Bekenntnis: Ich bin weder Thriller-Liebhaberin noch IT-affin. McCartens Thriller bezeichne ich auch weniger deshalb als Pageturner, weil er einige meiner Vorbehalte gegen Mobiltelefone und TV-Geräte bestätigt; vielmehr lässt er Leser und Leserin an einem Gedankenexperiment teilhaben, das bei aller Bedrohlichkeit zugleich abschreckend und faszinierend wirkt – eine uneingeschränkte Empfehlung!
Die Terminologie entstammt einem Spiel, in dem die geballte Macht von staatlichen Sicherheitsorganen und Hightech gegen zehn Individuen antritt. Diese können dem Private Public Partnership „Fusion“ nur ein erfindungsreiches Lowtech oder, besser noch, Notech entgegensetzen, um nicht geortet und ergriffen zu werden. Die Wertschätzung der Einzelnen durch „Fusion“ lässt sich bereits an ihrer Bezeichnung als „Zero“ mit durchgehender Nummerierung von eins bis zehn ablesen.
Die Erzählweise scheint zunächst einfach: Von Kapitel zu Kapitel schwenkt die Aufmerksamkeit auf die jeweils andere Seite und rückt die Denk- und Arbeitsweise von deren Protagonisten und Protagonistinnen in den Fokus. Ab der Mitte der 460 Seiten, wenn die Hälfte der Individuen schon geschnappt ist, könnte dieses Verfahren langsam langweilig werden, doch da werden die Verhältnisse auf beiden Seiten immer komplexer: Zero 10 verdoppelt sich, und in der Geschlossenheit von „Fusion“ tun sich unerwartet Risse auf; zudem offenbaren anfängliche Antagonisten plötzlich gewisse Ähnlichkeiten – wo Menschen agieren, gibt es keine dauerhafte Eindeutigkeit. Kurz: aus Spiel wird Ernst, und die Spannung steigt. Dabei gerät die raffinierte Gestaltung erzählerischer Einzelheiten nie aus dem Blick, z. B. der Klang von Eigennamen, die eine Nähe zur außerliterarischen Realität andeuten und zugleich verneinen.
Abschließend ein zweifaches Bekenntnis: Ich bin weder Thriller-Liebhaberin noch IT-affin. McCartens Thriller bezeichne ich auch weniger deshalb als Pageturner, weil er einige meiner Vorbehalte gegen Mobiltelefone und TV-Geräte bestätigt; vielmehr lässt er Leser und Leserin an einem Gedankenexperiment teilhaben, das bei aller Bedrohlichkeit zugleich abschreckend und faszinierend wirkt – eine uneingeschränkte Empfehlung!
Autor: Annika Reich
Anatomie ohne Genese - 3 Sterne
Es geht um HERRschaft, das wird früh im Erzählverlauf klar. Die Ausübung dieser Herrschaft durch eine Frau lenkt die Aufmerksamkeit allerdings auf die Wurzel des Begriffs: auf den HERRn, der in allen drei dargestellten Generationen abwesend ist und nur einmal, bereits als Toter, einen von der Herrin inszenierten „Auftritt“ hat: Die Großmutter begräbt den Großvater, nachdem sie sich den Schmuck, den er ihr angeblich schenkt, jahrelang selber zugeschickt hat. „Männer sterben bei uns nicht“, da sie im Herrschaftsbereich der Großmutter gar nicht leben.
Aber auch andere, Frauen, sind aus diesem Bereich verbannt, so die Schwester der Großmutter und die geliebte ältere Schwester der Ich-Erzählerin. Andere befinden sich auf dem Anwesen in einer Art innerer Verbannung wie die Mutter mit ihrem ordinären Geschmack und dem Junkfood, mit dem sie ihre Tochter ernährt. Die Tochter findet die Verbannten mit der Zeit wieder und erhält von ihnen gesprächsweise das zum Verständnis der großmütterlichen Herrschaft erforderliche Orientierungswissen: „Das Anwesen war ihr Phallus, aber natürlich ein geliehener. Deswegen musste sie es noch strenger beherrschen, als es ein Mann je hätte beherrschen müssen. So wurde sie zur Patriarchin.“ (S.136)
Auf dieser theoretischen Basis bleiben grundlegende Fragen zur individuellen Psyche ungestellt: Welche (Ohnmachts-?)Erfahrung hat die Großmutter so herrschsüchtig werden lassen? Woher stammt der Reichtum, dessen sie sich zur Durchsetzung ihrer Herrschaft bedient? Warum fügen sich ausnahmslos alle Ausgegrenzten widerstandslos dem Willen der Großmutter? Nicht einmal die aufmüpfige ältere meldet sich bei der ehedem von ihr verhätschelten jüngeren Schwester – warum nicht? Derartige Fragen zielen auf die Entstehung, die Genese, einer Herrschaft ab, die in ihren Erscheinungsformen, quasi ihrer Anatomie, durchaus überzeugend geschildert wird. Die geschmackliche Prägung der Ich-Erzählerin durch die Großmutter etwa scheint immer wieder durch, aber warum stellt das Kind keine einzige Frage zu den toten Frauen, die am Seeufer angespült werden..?
Das Stillleben auf dem Schutzumschlag fasst dieses Erzählen und seine – gewollten? – Lücken bildhaft zusammen: Unter einem opulenten Strauß aus Pfingstrosen und Flieder schwimmen in einer japanischen Fayence-Schale kleine Goldfische – ein prächtiges Bild üppiger Fülle. Bei näherem Hinsehen jedoch entdeckt man eine Bruchstelle, durch die Wasser aus der Schale ausgetreten ist und eines der Fischlein mitgerissen hat – es zappelt sterbend auf dem Trockenen … und eine der daneben liegenden Quitten scheint bereits angefault.
Aber auch andere, Frauen, sind aus diesem Bereich verbannt, so die Schwester der Großmutter und die geliebte ältere Schwester der Ich-Erzählerin. Andere befinden sich auf dem Anwesen in einer Art innerer Verbannung wie die Mutter mit ihrem ordinären Geschmack und dem Junkfood, mit dem sie ihre Tochter ernährt. Die Tochter findet die Verbannten mit der Zeit wieder und erhält von ihnen gesprächsweise das zum Verständnis der großmütterlichen Herrschaft erforderliche Orientierungswissen: „Das Anwesen war ihr Phallus, aber natürlich ein geliehener. Deswegen musste sie es noch strenger beherrschen, als es ein Mann je hätte beherrschen müssen. So wurde sie zur Patriarchin.“ (S.136)
Auf dieser theoretischen Basis bleiben grundlegende Fragen zur individuellen Psyche ungestellt: Welche (Ohnmachts-?)Erfahrung hat die Großmutter so herrschsüchtig werden lassen? Woher stammt der Reichtum, dessen sie sich zur Durchsetzung ihrer Herrschaft bedient? Warum fügen sich ausnahmslos alle Ausgegrenzten widerstandslos dem Willen der Großmutter? Nicht einmal die aufmüpfige ältere meldet sich bei der ehedem von ihr verhätschelten jüngeren Schwester – warum nicht? Derartige Fragen zielen auf die Entstehung, die Genese, einer Herrschaft ab, die in ihren Erscheinungsformen, quasi ihrer Anatomie, durchaus überzeugend geschildert wird. Die geschmackliche Prägung der Ich-Erzählerin durch die Großmutter etwa scheint immer wieder durch, aber warum stellt das Kind keine einzige Frage zu den toten Frauen, die am Seeufer angespült werden..?
Das Stillleben auf dem Schutzumschlag fasst dieses Erzählen und seine – gewollten? – Lücken bildhaft zusammen: Unter einem opulenten Strauß aus Pfingstrosen und Flieder schwimmen in einer japanischen Fayence-Schale kleine Goldfische – ein prächtiges Bild üppiger Fülle. Bei näherem Hinsehen jedoch entdeckt man eine Bruchstelle, durch die Wasser aus der Schale ausgetreten ist und eines der Fischlein mitgerissen hat – es zappelt sterbend auf dem Trockenen … und eine der daneben liegenden Quitten scheint bereits angefault.
Autor: Birnbacher, Birgit
fight or flight … - 4 Sterne
… in die Enge getrieben, können Tier wie Mensch sich zwischen diesen beiden Optionen entscheiden (besagte die Physiologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts). Umgelegt auf gegenwärtige Verhältnisse im ländlichen Raum: bleiben oder gehen?
Beide Möglichkeiten werden im Roman durchgespielt von einer Frau und einem Mann in der Krise. Sie, im Dorf aufgewachsen, ist gegangen: geflüchtet vor Sprachlosigkeit, Frauenverachtung und Perspektivlosigkeit. Er, der Städter, ist aufs Land gekommen, um zu bleiben und sich für einen Sinn in seinem Leben einzusetzen: um zu kämpfen. Diese Rolle füllt er im Wesentlichen bruchlos aus, während das Leben der Ich-Erzählerin von Brüchen gekennzeichnet ist: In ihrer beruflichen und gesundheitlichen Krise ist sie zurückgekehrt und sucht wieder Schutz im Elternhaus. In der Folge ist sie neuerlich männlicher Vereinnahmung ausgesetzt: Zwar lebt sie einen kurzen Sommer lang ihre Liebe zum Städter ohne existentielle = weiterführende Fragen; sobald er jedoch beginnt, fraglos eine gemeinsame Zukunft ins Auge zu fassen, tritt sie wiederum den Rückzug an. Auch die ‚Erpressung‘ ihres Vaters durch Selbstverletzung kann sie nicht zum Bleiben bewegen – im Gegensatz zu ihrer Mutter, die sich zur Aufgabe einer neuen Beziehung und zur Rückkehr in die alten Verhältnisse moralisch zwingen lässt.
Letztlich bleiben aber alle Lebenswege unabgeschlossen, und der Roman spielt nur Möglichkeiten durch, „wovon wir leben“ könnten. ‚Erfolg‘ oder ‚Scheitern‘ von Kampf oder Flucht werden nicht vorgeführt. Eine gewisse Stereotypie der Geschlechterrollen lässt sich allerdings auch dieser behutsamen Erzählweise nicht absprechen.
Beide Möglichkeiten werden im Roman durchgespielt von einer Frau und einem Mann in der Krise. Sie, im Dorf aufgewachsen, ist gegangen: geflüchtet vor Sprachlosigkeit, Frauenverachtung und Perspektivlosigkeit. Er, der Städter, ist aufs Land gekommen, um zu bleiben und sich für einen Sinn in seinem Leben einzusetzen: um zu kämpfen. Diese Rolle füllt er im Wesentlichen bruchlos aus, während das Leben der Ich-Erzählerin von Brüchen gekennzeichnet ist: In ihrer beruflichen und gesundheitlichen Krise ist sie zurückgekehrt und sucht wieder Schutz im Elternhaus. In der Folge ist sie neuerlich männlicher Vereinnahmung ausgesetzt: Zwar lebt sie einen kurzen Sommer lang ihre Liebe zum Städter ohne existentielle = weiterführende Fragen; sobald er jedoch beginnt, fraglos eine gemeinsame Zukunft ins Auge zu fassen, tritt sie wiederum den Rückzug an. Auch die ‚Erpressung‘ ihres Vaters durch Selbstverletzung kann sie nicht zum Bleiben bewegen – im Gegensatz zu ihrer Mutter, die sich zur Aufgabe einer neuen Beziehung und zur Rückkehr in die alten Verhältnisse moralisch zwingen lässt.
Letztlich bleiben aber alle Lebenswege unabgeschlossen, und der Roman spielt nur Möglichkeiten durch, „wovon wir leben“ könnten. ‚Erfolg‘ oder ‚Scheitern‘ von Kampf oder Flucht werden nicht vorgeführt. Eine gewisse Stereotypie der Geschlechterrollen lässt sich allerdings auch dieser behutsamen Erzählweise nicht absprechen.